Radikal aktiv
17. November 2020
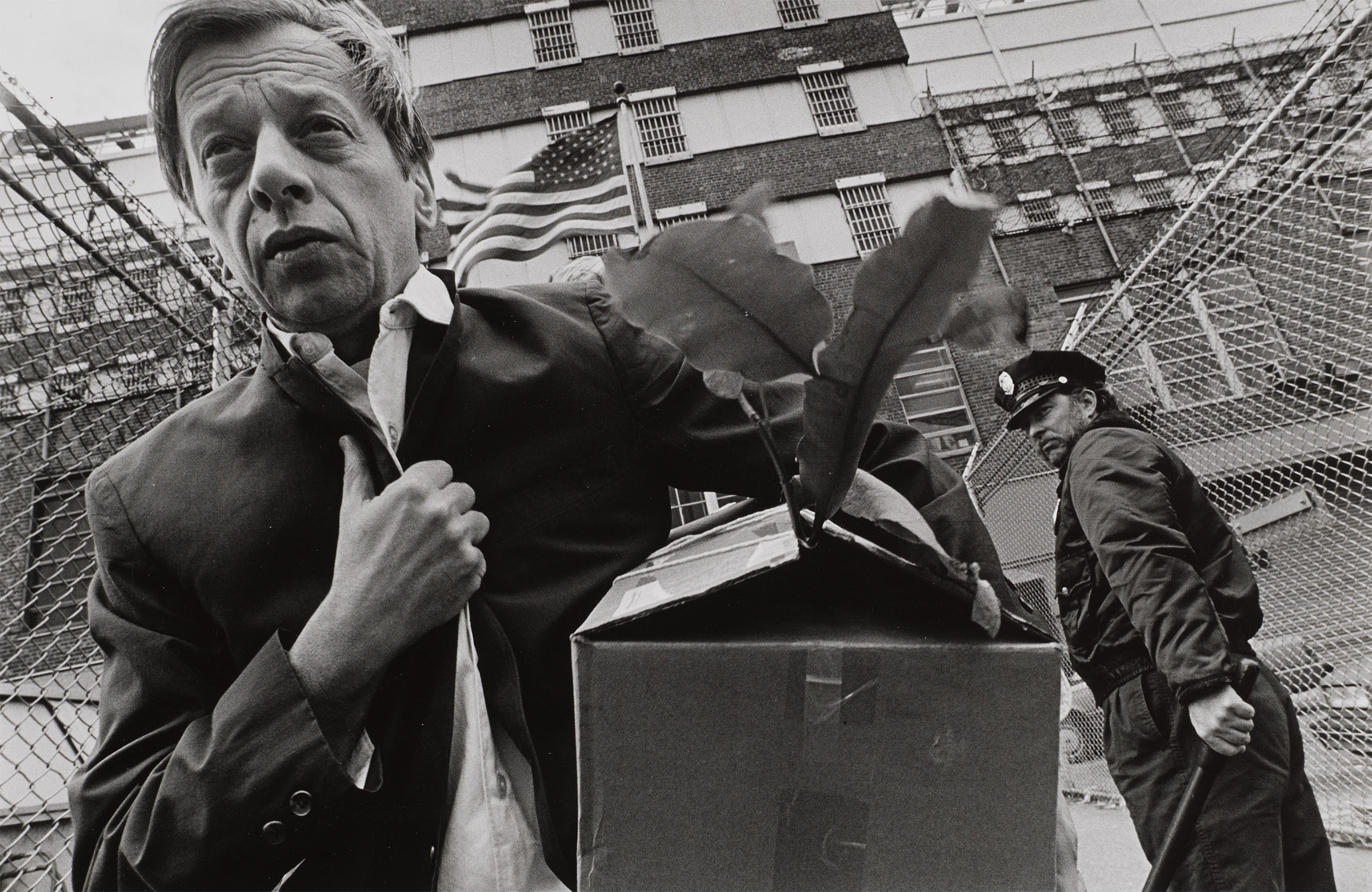
JERRY BERNDT, NEW YORK, 1983. FOTO: EUGENE RICHARDS. COURTESY THE JERRY BERNDT ESTATE 2020
17. November 2020
Es war eine filmreife Szene, die sich 1970 auf dem Campus der Harvard University abspielte. Das FBI war auf einen Besuch vorbeigekommen. Zwei Männer in schwarzen Anzügen und mit Pistolen im Schulterhalfter zückten ihre Dienstausweise und verlangten nach Jerry Berndt. Im Auftrag der Medical School der Universität hatte Berndt die sozialen und ökonomischen Strukturen des Bostoner Rotlichtbezirks fotografiert. Die daraus entstandene Serie Combat Zone sollte seine erste über Jahre erarbeitete kohärente fotografische Arbeit werden. Die Beamten interessierten sich jedoch vor allem für den Kuba-Aufenthalt des Fotografen im Jahr 1969.
»Ich schlug die Tür zu und dachte, oh Scheiße, das war's mit meinem Job«, erinnerte sich der 2013 verstorbene Fotograf später. »Ich hatte das seltsame Gefühl, dass ich noch viele dieser Jungs sehen würde.«
Berndts erster Kontakt mit dem amerikanischen Geheimdienst fand bezeichnenderweise in einer Dunkelkammer statt. Das FBI hatte ihn bei dem Versuch, Fotos aus Kuba in die USA zu schmuggeln beobachtet und die Filme konfisziert. »Ein Agent kam mit etwa 100 Filmrollen in einem Aktenkoffer an, der mit Handschellen an sein Handgelenk gefesselt war«, so Berndt. Als die ersten Rollen entwickelt waren, musste der Agent jedoch feststellen, dass sich der angebliche Verdacht, die Filme könnten pornographisches Material enthalten, nicht erhärten ließ. Berndt erhielt seine Filme zurück. Doch er war vorgewarnt.
Berndt, der bereits als Teenager aufgrund der Teilnahme Demonstration
für gleiche Bürgerrechte im Gefängnis saß, engagierte sich früh für die
afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung und organisierte Proteste gegen
den Vietnam-Krieg. Ohne Vorkenntnisse gelingt es Berndt zu Beginn der
1960er-Jahre, an der Universität von Wisconsin in Madison eine
Anstellung als Fotolaborant zu erhalten. Mit Unterstützung seiner
Kommiliton*innen und den Lehrbüchern von Ansel Adams erwirbt er alle
notwendigen Fähigkeiten in der Dunkelkammer sowie zum Fotografieren.
Seine Tätigkeit verknüpft er direkt mit seinem politischen Engagement.
Er fotografierte für Untergrund-Zeitungen, schrieb Texte für
Flugblätter, beriet Kriegsdienstverweigernde, hielt Reden und drehte
aufrührerische Filme. Bei Demonstrationen wurde Berndt von der Polizei
körperlich attackiert und verletzt. Doch das reichte zu diesem Zeitpunkt
noch nicht, um die Aufmerksamkeit des FBI zu wecken.
Im Jahr 1969 reiste Berndt schließlich mit den Venceremos-Brigaden,
einer studentischen Organisation zur Unterstützung der revolutionären
Bewegung, nach Kuba. Die linksliberalen Brigaden, die junge
Amerikaner*innen rekrutierten, um in Kuba bei landwirtschaftlichen und
infrastrukturellen Projekten zu helfen, waren der US-Regierung schon
lange ein Dorn im Auge. Kurz zuvor hatte ein US-Senator die Mitglieder
der Organisation als »menschliche Raketen« bezeichnet, die auf das Herz
der amerikanischen Demokratie abzielen. In einem eigens dafür
eingerichteten Überwachungsprogramm sollte die Gefährdung der nationalen
Sicherheit durch Kuba-Reisen linksliberaler US-Amerikaner*innen
bewiesen werden.
Als Berndt damit beginnt Aktivist*innen für die
Venceremos-Brigaden anzuwerben, ist für die Sicherheitsbehörden eine
rote Linie überschritten. Am 12. Januar 1970 beginnt laut FBI-Akten die
offizielle Beobachtung des Fotografen durch den Geheimdienst.
In Aktenstapeln gemessen scheint die Überwachung Berndts allerdings
keine allzu groß angelegte Operation gewesen zu sein. Nur zehn Seiten
sind heute einsehbar und befinden sich im Besitz des Jerry Berndt
Estate. Die Akten zeichnen ein eher nüchternes Bild: Enthalten sind
Vermerke über Berndts Verhaftung, seine Kuba-Reisen und berufliche
Situation sowie Adressüberprüfungen. Berndt wird als »Anarchist«
geführt, eine »radikale Aktivität« wird ihm 1972, im letzten Jahr seiner
Überwachung, zugeschrieben. Umfassende Informantenberichte, Analysen,
Fotos oder Abhörprotokolle sucht man allerdings vergebens. Auch in den
öffentlich zugänglichen Archiven der Geheimdienste findet sich kein
Eintrag unter seinem Namen. Es ist allerdings möglich, dass Akten
verloren gingen oder bestimmte Überwachungsmaßnahmen undokumentiert
blieben.
Berndt selbst empfand die Überwachung als bedrohlicher als die Dokumente
auf den ersten Blick vermitteln. Letztlich zeugen seine Aussagen vom
immensen politischen Druck, dem sich die Bürgerrechts- und
Anti-Kriegsbewegung ausgesetzt sah: »Die Repressionen wurden immer
heftiger. Man hatte keinen Zugang zur Presse. Zwanzigtausend
Student*innen protestierten gegen Vietnam, aber die Presse sprach von
zweitausend.«
Offensichtlich fühlte sich Berndt vom FBI zunehmend verfolgt und
drangsaliert. Immer schwieriger wurde es für ihn, als Fotograf Arbeit zu
finden. Auch Freunde wie der Aktivist und ehemalige Redakteur der
Untergrund-Zeitung Old Mole
Dick Cluster berichten, wie der Geheimdienst Freund*innen und
potentielle Arbeitgeber unter Druck setzte. Einzig der Verleger der
Detroit Area Weekly Newspaper, der die durch Antikommunismus und
Verschwörungstheorien geprägten Anhörungen der McCarthy-Ära in den
1950er-Jahren miterlebt hatte, beschäftigte Berndt hin und wieder als
Fotograf. Ob diese Schilderungen der Realität entsprechen, lässt sich
anhand der FBI-Akten nachweisen.
Zermürbt und desillusioniert vom Zerfall der Bürgerrechtsbewegung
begann sich Berndt schließlich mehr und mehr zurückziehen. 1973 bezog er
ein besetztes Haus in Boston, das er jedoch nur nachts verließ. Er
begann zu trinken, pflegte kaum noch Kontakte zu ehemaligen Freund*innen
und Wegbegleiter*innen. »Die Überwachung durch das FBI ist sicher nur
ein Teil dieser fundamentalen Entwurzelung«, sagt Sabine Schnakenberg,
Kuratorin der Ausstellung BEAUTIFUL AMERICA. Mit dem Ende der
Protestbewegung in den USA wird Berndt auf sich selbst zurückgeworfen.
Er beginnt sich stärker auf sich selbst konzentrieren.
Dieser Zustand
der Isolation bringt schließlich Nite Works hervor, eine seiner
berühmtesten Serien, die Nachtaufnahmen in den menschenleeren
Großstädten Amerikas zeigen. Berndt wird diese Serie bis zu seinem
Lebensende weiterführen. Die Straßen auf den Bildern sind leergefegt,
aber dennoch ist eine unsichtbare Bedrohung spürbar.
In der kunsthistorischen Betrachtung von Jerry Berndts Werk hat die
Beobachtung des Fotografen durch das FBI einen wichtigen Stellenwert
eingenommen. Die Kunstkritik hat Berndts Aussagen für sich genutzt und
weitererzählt – faktisch belegen lassen sie sich aufgrund fehlender
Quellen jedoch kaum. Der Gegensatz zwischen Berndts eigener Wahrnehmung
und der Aktenlage bleibt bestehen. Geheimdienstliche und künstlerische
Realität scheinen sich am Ende gegenseitig zu manipulieren und zu
ergänzen.
Die Ausstellung JERRY BERNDT – BEAUTIFUL AMERICA ist noch bis zum 7. Februar 2021 im Haus der Photographie zu sehen.