Erinnern, um vergessen
zu können
9. August 2022

FOTO: HENNING ROGGE
9. August 2022
Die Fotografie ist seit jeher ein Medium der Erinnerung. Doch wie das menschliche Gedächtnis ist sie nicht perfekt und voller Fehler – sie kann uns betrügen, täuschen und in die Irre führen. Hin und wieder manipuliert sie uns auch, im öffentlichen Leben genauso wie im privaten. Dabei sind Erinnerungen meist genauso selektiv wie unsere individuellen Wahrnehmungen. Für den Soziologen und Philosophen Maurice Halbwachs werden sie stärker von der Gegenwart bestimmt als von der Vergangenheit.
In der Ausstellung CURRENCY: PHOTOGRAPHY BEYOND CAPTURE in den Deichtorhallen Hamburg hinterfragen und überprüfen mit Raed Yassin, Lebohang Kganye, Leslie Hewitt und Mame-Diarra Niang gleich vier Künstler*innen das Wahrheitsversprechen der Fotografie. Sie begeben sich auf die Suche nach der Bedeutung, aber auch nach den Lücken des Mediums und wie diese das individuelle wie das kollektive Gedächtnis prägen.
Interessanterweise spielen dabei aber nicht Nachrichtenbilder oder Werbefotografien, sondern ausgerechnet private Fotos, etwa aus dem Familienalbum, eine wichtige Rolle. Diese Aufnahmen sind schließlich essenzielle und oft auch die einzigen fotografischen Dokumente der eigenen Geschichte und Herkunft. Sie prägen unsere Selbstwahrnehmung und auch unsere Identität.
Doch was geschieht, wenn diese Fotografien verloren gehen – sei es durch Naturkatastrophen wie die Flut im Ahrtal, den Tsunami in Japan oder in einem der vielen Kriege weltweit?
So erging es Raed Yassin. Der
43-Jährige hat im libanesischen Bürgerkrieg einen Großteil seiner
Familienfotos verloren. Um diese schmerzhafte Lücke zu füllen, kaufte
und sammelte er Familienfotos anderer Menschen, vor allem aus dem
arabischen Raum. In dieser Region kam es in den letzten Jahrzehnten zu
vielen Vertreibungen und Veränderungen, und gleichzeitig ähneln sich die
Familienalben selbst völlig fremder Familien untereinander so, wie sie
es auch in Mitteleuropa tun: Die Menschen sind zwar unterschiedlich,
aber interessanterweise scheinen sie alle ähnliche Erfahrungen zu machen
– zumindest dann, wenn man den selektiven Bildern in den Fotoalben
trauen kann, die meist voll sind mit Urlaubsbildern, Hochzeiten, Taufen
und anderen Familienfesten.
Für Yassin bedeuten die Bilder dieser Menschen eine Art
Familienersatz, der sich für ihn eine Zeit lang kostbar und heilend
anfühlte. Doch als immer mehr Fotografien von immer mehr Menschen
zusammenkamen, veränderte sich die Wirkung der Bilder und er hat sie
zunehmend als Belastung empfunden – schließlich trägt jede Fotografie
auch das individuelle Schicksal eines Menschen und seiner Familien in
sich.
Nachdem die Menschen verschwunden waren – durch Tod oder Vertreibung – begann Yassin damit, auch ihre Abbilder aufzulösen. Er besprühte die Fotografien mit Farbe, so dass sie auf den ersten Blick komplett überdeckt wurden. Erst bei genauerer Betrachtung erkennt man noch etwas – die Farbe (hier eine Metapher für die verstrichene Zeit) hat nicht alles verdeckt und so erkennen wir manchmal noch Silhouetten und Schemen, manchmal aber auch Konturen von Gesichtern.
Es sind die Gespenster von Kindern und Erwachsenen, die uns daran erinnern, dass sie einmal existiert haben. Damit gelingt Yassin auf gewisse Weise die Quadratur des Kreises: Er visualisiert etwas, dass es nicht mehr gibt.
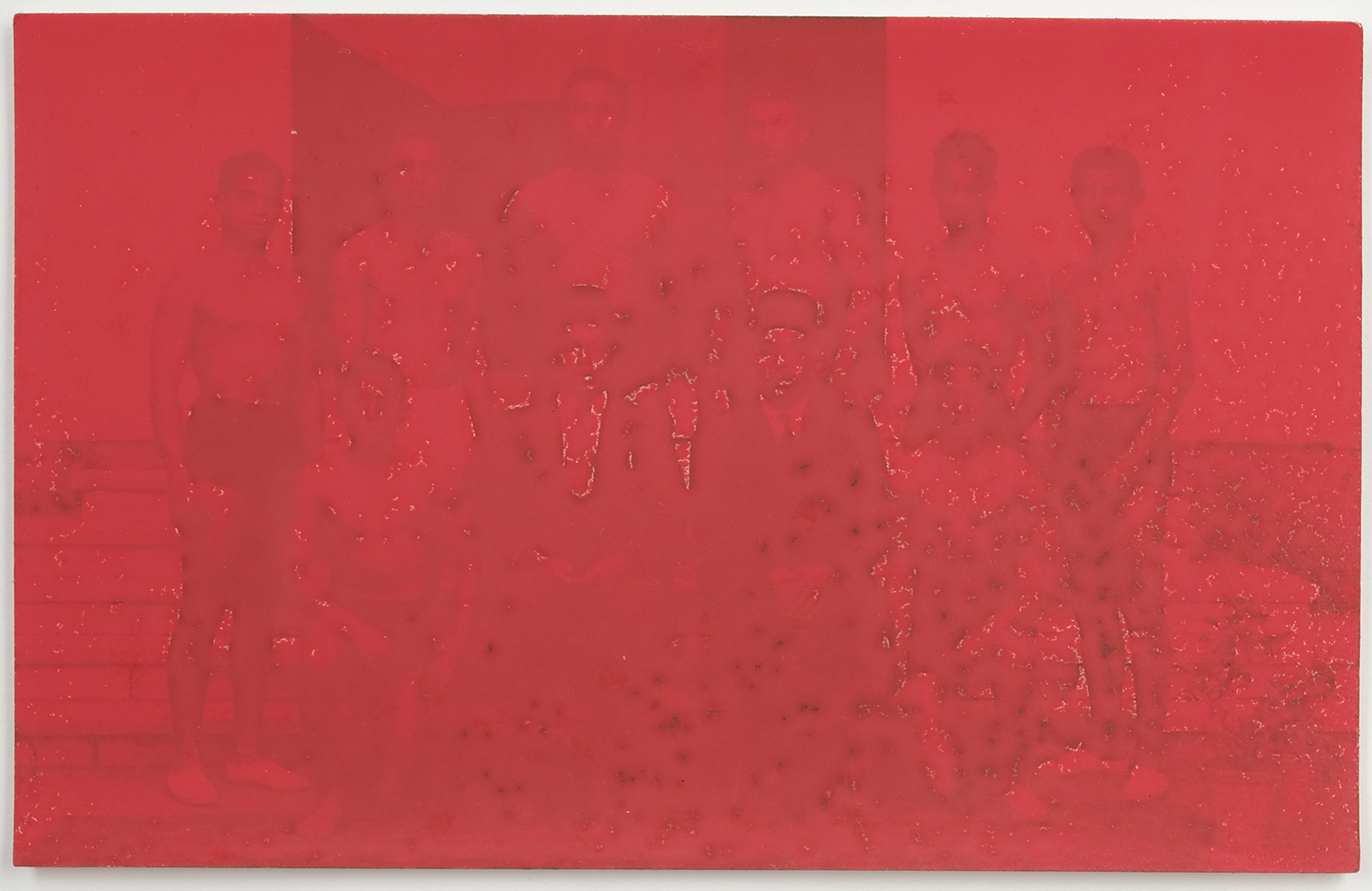
Auch die südafrikanische Künstlerin Lebohang Kganye arbeitet
üblicherweise mit alten Familienfotos, die nicht unbedingt ihre eigene
Familie zeigen. Kganye vermischt die Fotos mit Erzählungen und
weitergegebenen Erinnerungen zu lebensgroßen Skulpturen und
raumgreifenden Installationen. Die Personen werden aus dem Kontext der
Fotografien entrissen, stark vergrößert auf Platten aufgezogen und so
arrangiert, dass sie – einem Bühnenstück gleichend – miteinander
interagieren.
Es sind dreidimensionale Collagen alltäglicher Szenen des
Landlebens, die sich mit jedem Schritt der Betrachtenden verändern und
neue Perspektiven ermöglichen. Wie die Bilder in einem Pop-up-Buch für
Kinder oder Dioramen in einem Naturkundemuseum, die für exemplarische
und meist stark verdichtete Imitation von Wirklichkeit stehen und
ebenfalls ähnlich einer Fotografie funktionieren, tragen sie auch etwas
Spielerisches in sich.
Zusätzlich drängt sich eine weitere Ebene und
Interpretationsmöglichkeit auf, nämlich die der Familienaufstellung.
Welche Figuren und Charaktere positioniert Lebohang Kganye, die sich
selbst auch als Geschichtenerzählerin bezeichnet, wo und in welchem
Verhältnis stehen diese zu den anderen? Wie verändert sich der Blick der
Betrachtenden beim Gang um die insgesamt vier Installationen, die in
der gesamten Ausstellungsfläche verteilt an verschiedenen Positionen
aufgestellt wurden?

In diesem Punkt unterscheidet sich die Präsentation in den
Deichtorhallen Hamburg von der ursprünglichen Ausstellung der Arbeit,
die Kganye 2018 für das Pretoria Art Museum in Südafrika entwickelt
hatte. Damals standen die vier Dioramen um eine Lampe herum, die
unterschiedliche Licht- und Schatteneffekte erzeugte. Damit bezog sich
die 1990 geborene Künstlerin auf die ursprüngliche Bedeutung ihres
Familienamens Kganye, der abgeleitet aus der Zulu- und Sotho-Sprache so
viel wie »Licht« und »leuchten« bedeutet.
Und auch der Titel der Arbeit Mohlokomedi wa Tora
greift diese Bezüge auf: übersetzt bedeutet er »Leuchtturmwärter«. Es
geht also um das Er- und Ausleuchten der eigenen komplexen
Familiengeschichte Kganyes selbst und natürlich auch um den fast
schicksalhaften Zufall, dass die Künstlerin sich mit dem Medium
Fotografie beschäftigt, das ohne Licht gar nicht denkbar wäre. Aber
natürlich ist der Leuchtturm auch ein sehr ambivalentes Symbol:
Einerseits dient er der Orientierung und andererseits darf man ihm nicht
zu nahe kommen.
Wie gesellschaftliche und historische Ereignisse unterschiedlich
gewichtet und entsprechend in den Vorder- oder Hintergrund der
Erinnerung gestellt werden, beschäftigt die Amerikanerin Leslie Hewitt.
Die Fotografie ist bei diesem Erinnerungsprozess niemals objektiv und
kann nicht als wirklicher Beweis aufgeführt werden, sondern sie ist
immer Teil und Ergebnis von Entscheidungsprozessen und bei ihrer
Betrachtung spielt der Kontext und die mitgelieferte Information eine
entscheidende Rolle.

In ihrer Arbeit Riffs on Real Time arbeitet die 45-Jährige
in mehreren Schichten aus Fotografien und Trägermaterial: Ein hölzerner
Fußboden bildet den privaten und persönlichen Hintergrund für einen auf
ihm liegenden Zeitungsartikel, Magazin, Buch oder auch Landkarte – in
jedem Fall handelt es sich um ein Druckerzeugnis, welches als
Informationsquelle und Massenmedium dient. Auf diesem wiederum platziert
Hewitt ein altes Familienfoto aus ihrem Archiv, das ein Teil dieser »öffentlichen« Geschichte mit ihrer eigenen »privaten« überlagert.
Thematisch bezieht sich die Afroamerikanerin dabei vor allem auf die
schwarze Community und die Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre in den
USA, an denen sich auch ihre Eltern beteiligten. In ihrer Arbeit bringt
die Künstlerin scheinbar nicht zusammenhängende Ereignisse und
Aktivitäten zusammen. Allerdings stellt Hewitt diese Assemblage nicht
selbst aus, sondern nur eine Fotografie davon. Damit fügt sie der
Infragestellung von Wahrheit und Erinnerung eine weitere Ebene hinzu:
Auch dieses Foto ist nur ein Bild und somit nur eine von vielen
Möglichkeiten der Wahrnehmung und der Gewichtung.
Dass Erinnerung und Vergessen die Menschheit nicht erst seit
Erfindung der Fotografie faszinieren, zeigt die Arbeit der Französin
Mame-Diarra Niang. Als Autodidaktin beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit
Léthé
mit dem gleichnamigen Fluss aus der griechischen Mythologie: Die Seelen
der Verstorbenen mussten aus ihm trinken und vergaßen daraufhin alles
aus ihrem vorangegangenen Leben, damit sie wiedergeboren werden konnten.
Für Niang steht dabei die Erinnerung der eigenen Identitätsfindung im
Weg. Wer wären wir, wenn wir nicht täglich durch uns selbst und andere
Personen an unser bisheriges Leben erinnert werden würden? »Ich stelle
mir das Selbst als ein Territorium vor, das aus gut kuratierten
Erinnerungen und Auslöschungen besteht. Wir müssen vergessen, was wir
waren, um neu zu werden«, sagt die 40-Jährige.

Die in der Ausstellung zu sehenden Fotografien sind während des
Corona-Lockdowns 2021 entstanden und interpretieren das Genre des
Porträts neu. Zwar sehen wir mehr oder weniger klassische Einzelporträts
von Personen, diese sind allerdings so stark verschwommen, dass eine
Identifizierung der Abgebildeten unmöglich gemacht wird. Wir erkennen
(und erinnern uns bloß an) Schemen, Umrisse und Farbflächen. Selbst bei
geliebten, aber bereits verstorbenen Personen fällt es uns mitunter
schwer, sich an ihre Gesichter zu erinnern. Ab wann ist ein Porträt ein
Porträt? Was glauben wir trotz der Unschärfe erkennen und interpretieren
zu können? Das Geschlecht? Den Gemütszustand? Die Hautfarbe? Das Alter?
Inspiriert wurde Mame-Diarra Niang dabei auch von ihren eigenen
Erfahrungen und ihrem Aufwachsen zwischen Frankreich, Senegal und der
Elfenbeinküste einerseits und den fehlenden Geschichten ihrer Vorfahren
andererseits: »Mein Vater hat mir nie meine Geschichte erzählt, unsere
Geschichte, die Geschichte meiner Vorfahren. Es bedeutet, dass ich mich
nicht vollständig erinnern kann. Ich kann mich nicht erinnern, wer ich
war, bevor ich ich selbst geworden bin.« Wer sich nicht erinnern
kann, der kann auch nicht vergessen.
__________
Damian Zimmermann (* 1976) lebt und arbeitet als Journalist, Kunstkritiker, Fotograf, Kurator und Festivalmacher in Köln.
Die Ausstellung CURRENCY: PHOTOGRAPHY BEYOND CAPTURE ist bis zum 18. September 2022 in der Halle für aktuelle Kunst zu sehen.